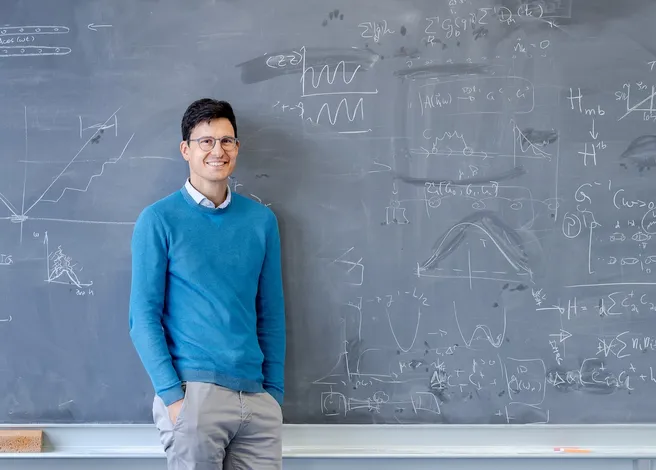Seit fast einem Jahrhundert sind die als Quasiteilchen bekannten Quantenobjekte theoretisch gut beschrieben, aber schwer gezielt zu steuern. Doch das könnte sich nun ändern: Ein Team von Physikern von der School of Natural Sciences der TUM und der Yale University hat gezeigt, dass es möglich ist, zumindest eine Art von Quasiteilchen gezielt zu beeinflussen.
Diese Entdeckung stellt jahrzehntelange wissenschaftliche Grundannahmen in Frage und könnte in der künftigen Quantenforschung vielfältige Anwendungen finden. Ein Quasiteilchen ist ein „emergentes“ Quantenobjekt – ein zentrales, grundlegendes Teilchen, das von anderen Teilchen umgeben ist, wobei die gesamte Struktur Eigenschaften zeigt, die in keiner einzelnen Komponente vorhanden sind. Quasiteilchen sind ein zentrales Konzept für das Verständnis wechselwirkender Quantensysteme, die unter anderem in der Quanteninformatik, in Sensoren und anderen Geräten genutzt werden könnten.
Allerdings sind sie aufgrund ihrer komplexen Wechselwirkungen mit anderen Teilchen in Quantensystemen schwer zu untersuchen. „Wechselwirkende Quantensysteme spielen eine zentrale Rolle in der modernen Quantenwissenschaft und -technologie, aber sie sind schwer zu verstehen“, erklärte Prof. Nir Navon, außerordentlicher Professor für Physik an der Yale Faculty of Arts and Sciences, Mitglied des Yale Quantum Institute und leitender Forscher der neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Physics veröffentlicht wurde.
„In manchen Fällen sorgen Wechselwirkungen lediglich dafür, dass Teilchen neue Eigenschaften annehmen, etwa eine veränderte Masse oder eine längere Lebensdauer – und so zu Quasiteilchen werden“, so Navon. „Was wir hier zeigen, ist eine neue und überraschende Art der Kontrolle: Durch die Anwendung eines einfachen „Reglers“ in Form eines externen Hochfrequenzfeldes konnten wir die Eigenschaften von Quasiteilchen gezielt beeinflussen. Es ist ein wenig so, als würde man ein Pferd in ein Einhorn verwandeln, indem man gezielt Staub um es herum aufwirbelt.“
Navons Labor an der Yale University führt Experimente durch, die Quantenphänomene simulieren. Damit untersucht das Team grundlegende wissenschaftliche Eigenschaften der Quantenwelt und wie diese beeinflusst werden können.
In ihrer neuen Studie untersuchten Prof. Navon und seine Kollegen, darunter der Theoretiker Prof. Michael Knap von der Technischen Universität München, die Manipulation der Eigenschaften eines bestimmten Typs von Quasiteilchen, der sogenannten Fermi-Polaronen. Fermi-Polaronen sind Quasiteilchen, die durch frei bewegliche Störstellen entstehen, die mit subatomaren Teilchen namens Fermionen wechselwirken.
Prof. Navon, Prof. Knap und ihre Kolleginnen und Kollegen schufen eine hochkontrollierte, „saubere“ Umgebung, um Fermi-Polaronen zu beobachten. Sie verwendeten lasergekühlte Atome, die auf Temperaturen im Nano-Kelvin-Bereich abgekühlt wurden (ein Nano-Kelvin entspricht einem Milliardstel Grad über dem absoluten Nullpunkt), sowie präzise Hochfrequenzkontrolle, um eine neue Stufe der Beeinflussung von Quasiteilchen zu erreichen.
„Die Fähigkeit, ein Quantensystem mit hoher Präzision zu kontrollieren, wie es in diesem Experiment geschehen ist, kann zur Erzeugung neuer Quantenzustände führen, die nicht den Gesetzen der Thermodynamik gehorchen“, erklärt Prof. Knap. „Unsere Aufgabe ist es nun, die Bedingungen für die Realisierung solcher exotischen Zustände zu erforschen.“
Die Erkenntnisse der Studie stellen langjährige Annahmen über Quasiteilchen in Frage und könnten völlig neue Möglichkeiten zur Untersuchung und Steuerung von Quantensystemen eröffnen. „Einige der interessantesten und bizarrsten Quantensysteme heutzutage sind diejenigen, die eigentlich keine Quasiteilchen enthalten“, erklärt Prof. Navon. „Es wäre fantastisch, wenn wir in der Lage wären, Quasiteilchen kontrolliert zu zerstören oder wiederherzustellen. Die Möglichkeit, mit einem Quantensystem zu beginnen, das Quasiteilchen enthält, und diese dann mit einem externen Feld zu zerstören, würde eine bemerkenswerte Brücke zwischen gut verstandenen Quantensystemen und jenen schlagen, die derzeit noch ein Rätsel sind.“
Weitere Autoren der Studie sind Franklin Vivanco und Songtao Huang (Yale) sowie Alexander Schuckert (University of Maryland). Unterstützt wurde die Forschung unter anderem von der National Science Foundation, DARPA, der David and Lucile Packard Foundation, der Alfred P. Sloan Foundation, der deutschen Exzellenzstrategie sowie der Europäischen Union.
Publikation
- Vivanco, Franklin J.; Knap, Michael; Navon, Nir; et al. The strongly driven Fermi polaron. Nature Physics. https://doi.org/10.1038/s41567-025-02799-8
Weitere Informationen und Links
Kontakte zum Artikel
Prof. Dr. techn. Michael Knap
Technische Universität München
TUM School of Natural Sciences
Professur für Kollektive Quantendynamik
michael.knap(at)ph.tum.de
Pressekontakt